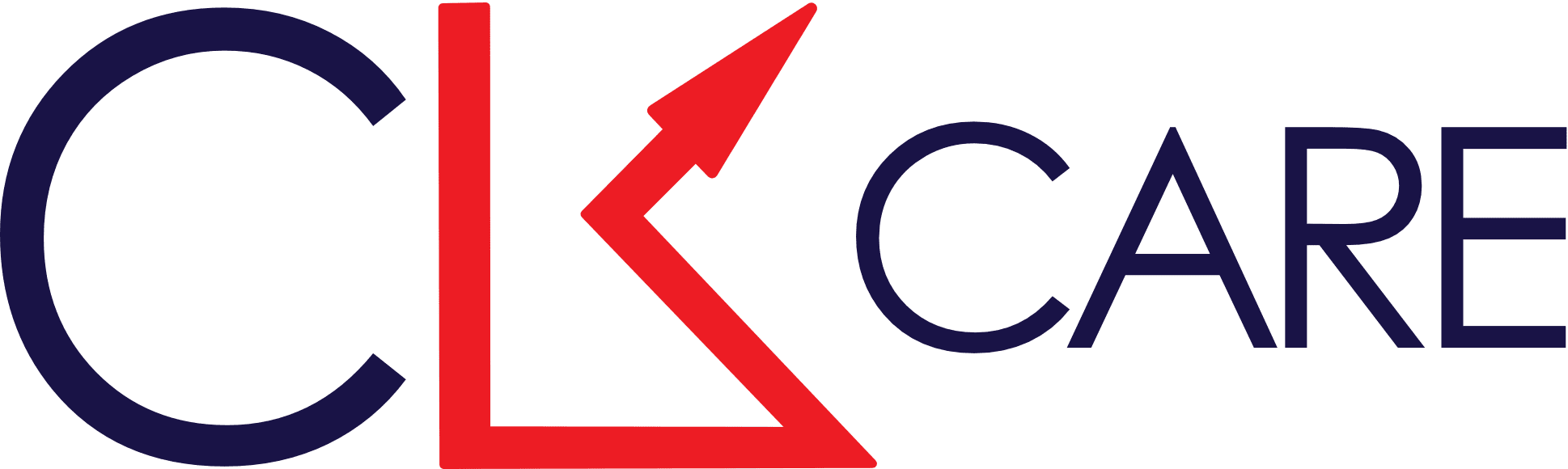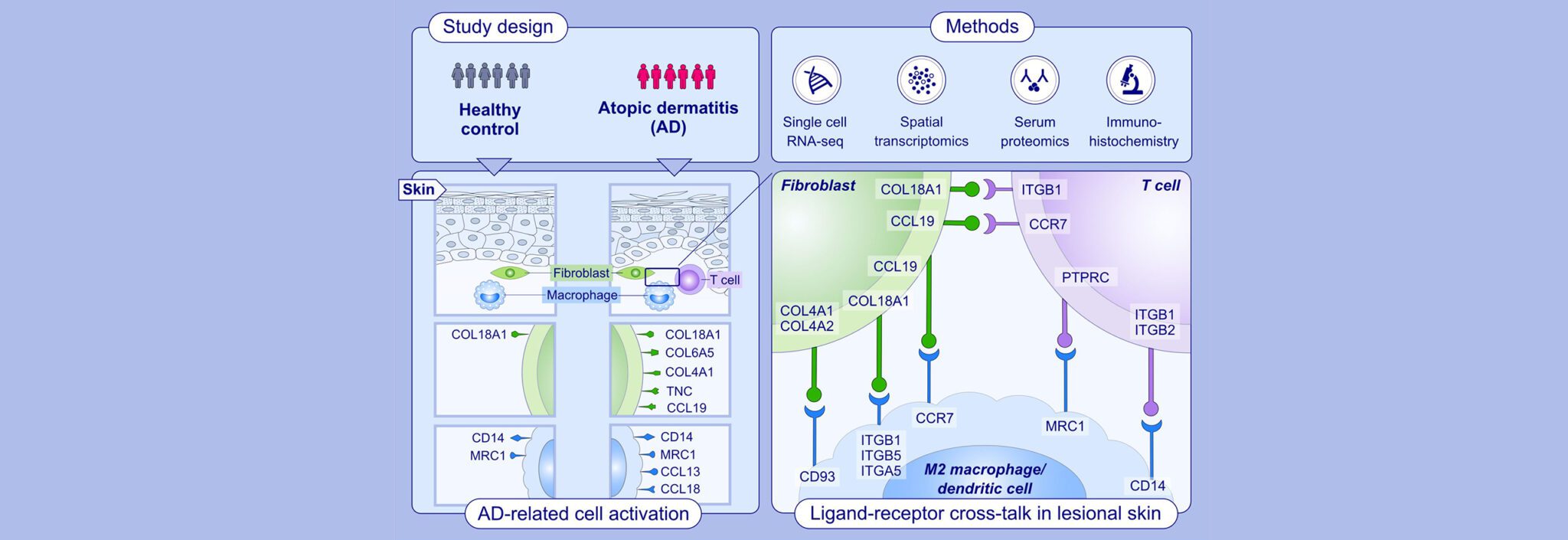Fliegen viele Pollen in der Aussenluft, kommt es zu erhöhten Infektionsraten mit SARS-CoV-2. Dies hat ein internationales Team unter der Leitung von Forschenden der Technischen Universität München (TUM) und des Helmholtz Zentrums München mit einer breit angelegten Studie gezeigt. Angehörige von Hochrisikogruppen könnten sich durch das Beobachten von Pollenflugvorhersagen und ein entsprechendes Tragen von Staubfiltermasken schützen.
Im Frühjahr 2020 schien der Ausbruch der Corona-Pandemie in der nördlichen Hemisphäre mit den Flugzeiten der Baumpollen zusammenzutreffen. Diese Beobachtungen nahm ein internationales Forschungsteam zum Anlass für eine umfassende Untersuchung: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollten herausfinden, ob es einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Pollenkonzentration in der Luft und Infektionszahlen mit SARS-CoV-2 gibt.
Pollen beeinflussen als wichtiger Umweltfaktor die Infektionsraten erheblich
Basierend auf der CK-CARE Forschung und unter der Federführung von Erstautor Athanasios Damialis sammelte das Team am Lehrstuhl für Umweltmedizin an der TUM Daten zu Pollenkonzentrationen in der Luft, zu meteorologischen Bedingungen und zu SARS-CoV-2-Infektionen – dabei wurden die Variationen der Infektionsrate von Tag zu Tag oder auch die Gesamtzahl positiv Getesteter berücksichtigt. In ihre Berechnung bezogen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch Daten zu Besiedelungsdichte und zu Effekten von Lockdowns ein. Die 154 Forschenden analysierten Pollendaten von 130 Stationen in 31 Ländern auf fünf verschiedenen Kontinenten.
Das Team zeigte, dass luftgetragene Pollen im Durchschnitt 44 Prozent der Varianz der Infektionsraten erklären können – manchmal spielten hier aber auch Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur eine Rolle. An Orten ohne Lockdown-Regelungen stieg die Infektionsrate im Schnitt um vier Prozent, wenn sich die Anzahl der Pollen in der Luft um 100 pro Kubikmeter erhöhte. In manchen deutschen Städten beispielsweise kamen im Untersuchungszeitraum zeitweise pro Tag bis zu 500 Pollen auf einen Kubikmeter – was insgesamt zu einem Anstieg der Infektionsraten um mehr als 20 Prozent führte. Galten in den untersuchten Gebieten Lockdown-Regeln, halbierte sich die Zahl der Infektionen im Schnitt jedoch bei vergleichbarer Pollenkonzentration in der Luft.
Pollenflug schwächt Körperabwehr
Der Grund: Wenn Pollen fliegen, reagiert die Körperabwehr in abgeschwächter Form auf Viren der Atemwege, die verantwortlich für Schnupfen und Erkältungen sind. Wenn ein Virus in den Körper gelangt, produzieren infizierte Zellen üblicherweise Signalproteine – auch bei SARS-CoV-2. Diese sogenannten antiviralen Interferone rufen benachbarte Zellen dazu auf, ihre antivirale Abwehr zu verstärken, um die Eindringlinge in Schach zu halten. Außerdem wird eine ausbalancierte Entzündungsreaktion aktiviert, um die Viren zu bekämpfen.
Ist allerdings die Pollenkonzentration in der Luft hoch und werden neben Viren auch Pollen eingeatmet, werden weniger solcher antiviralen Interferone produziert. Auch die eigentlich heilsame Entzündungsreaktion wird beeinflusst. Wenn viele Pollen fliegen, kann die Zahl der Atemwegserkrankungen daher ansteigen – dies gilt auch für Covid-19. Dabei spielt es keine Rolle, ob Betroffene an Allergien gegenüber diesen Pollen leiden oder nicht.
«Man kann nicht vermeiden, luftgetragenen Pollen ausgesetzt zu sein», sagt Stefanie Gilles, ebenfalls Erstautorin der Studie. «Personen, die zu Hochrisikogruppen gehören, sollten deshalb darüber informiert sein, dass erhöhte Pollenkonzentrationen in der Luft anfälliger gegenüber viralen Infekten der Atemwege machen. Athanasios Damialis betont: «Betrachtet man die Verbreitung des SARS-CoV-2, müssen Umweltfaktoren wie Pollen mit in die Rechnung aufgenommen werden. Das Wissen um diese Auswirkungen eröffnet neue Wege für die Prävention und Abmilderung von Covid-19.»
Staubfiltermasken schützen
Was also können Personen, die Risikogruppen angehören, tun, um sich zu schützen? Letztautorin Claudia Traidl-Hoffmann, Professorin für Umweltmedizin, Mitglied im Scientific Board von CK-CARE, rät, in den nächsten Monaten die Pollenflugvorhersagen zu Rate zu ziehen. Sie sagt: «Staubfiltermasken zu tragen, wenn die Pollenkonzentration hoch ist, kann das Virus und den Pollen gleichermassen von den Atemwegen fernhalten.»