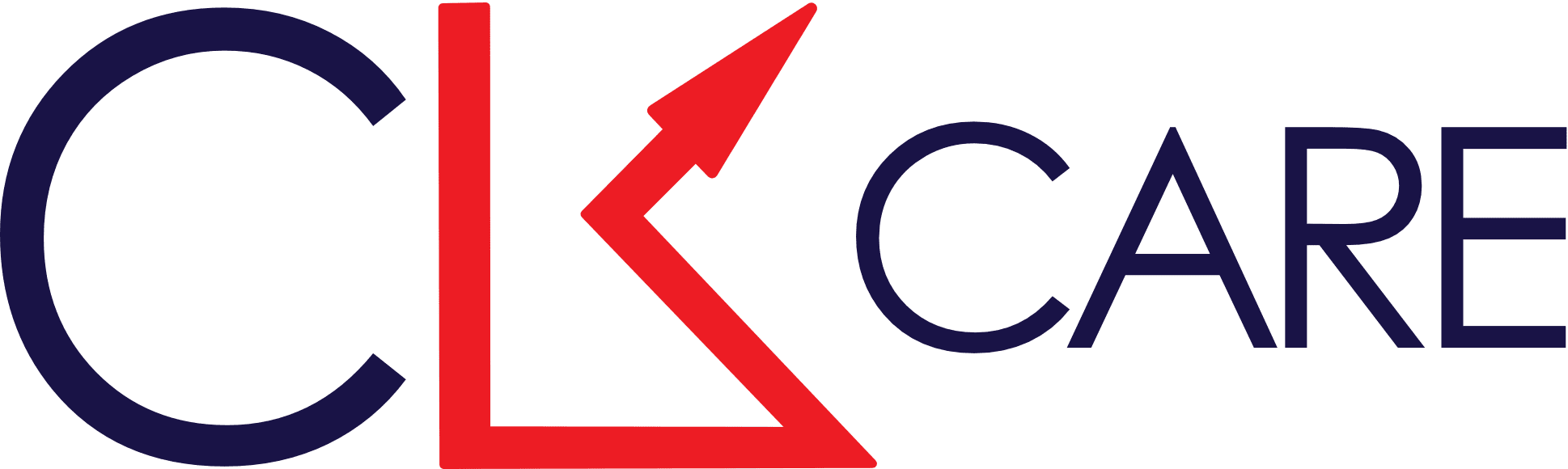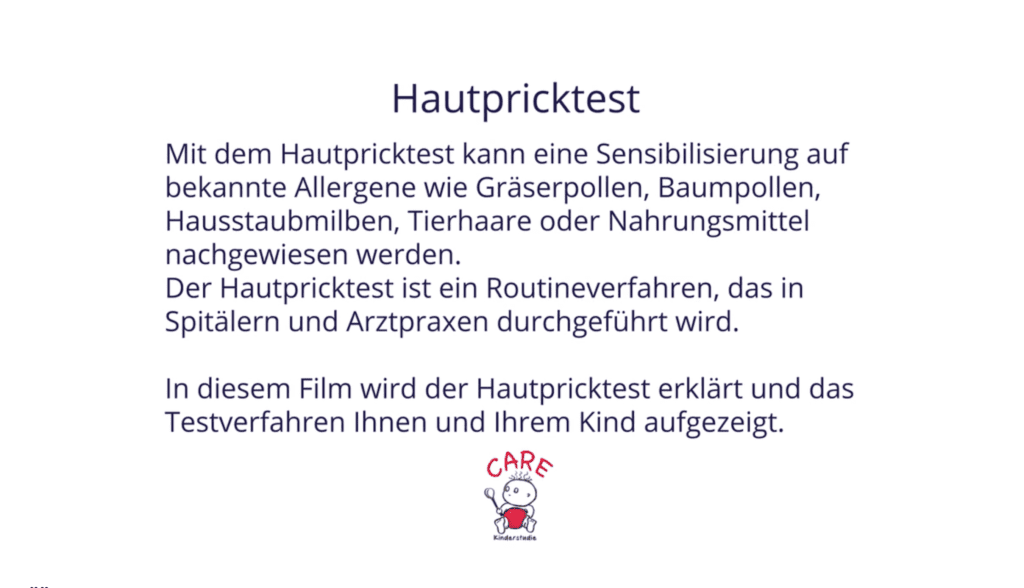CARE Kinderstudie
Finden Sie mit uns Antworten
darauf für eine gesunde Zukunft

CARE Kinderstudie
und Ihr Kind

CARE Kinderstudie
was bedeutet das für Sie und Ihr Kind

CARE Kinderstudie
kontaktieren Sie uns
Jedes dritte Kind leidet an Allergien
Ist jemand innerhalb der Verwandtschaft betroffen, so ist das Allergierisiko für das Neugeborene über 50%.
Dazu gehören Heuschnupfen, Asthma, Nahrungsmittelallergien und Neurodermitis (atopisches Ekzem/atopische Dermatitis).
Allergien nehmen weltweit zu. Das Ziel dieser Studie ist zu untersuchen, welche Rolle die Ernährung und andere Umwelteinflüsse bei diesem Anstieg haben. Wir wollen Veränderungen erkennen und verstehen, um daraus vorbeugende Massnahmen ableiten zu können.
Unterstützen Sie uns dabei und lassen Sie uns zusammen wertvolle Antworten für eine gesunde Zukunft finden.


Welche Vorteile haben Sie und Ihr Kind
- Ihr Kind wird regelmässig fachärztlich untersucht. Dabei kann das Auftreten von Allergien frühzeitig erkannt werden.
- Sollten wir bei Ihrem Kind Hinweise auf eine Allergie finden, können wir Sie über die wirksamsten Therapien aufklären.
- Sie und Ihr Kind tragen wesentlich dazu bei, dem vermehrten Auftreten von Allergien in Zukunft entgegenzuwirken.
„Wir sind ein Puzzleteil in der grossen Studie, die hoffentlich bald vielen zukünftigen Kindern das Leben mit Allergien leichter machen wird. Mitmachen lohnt sich, denn nur so können wir alle von dem Wissen profitieren!“
„Ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit. Für uns war die Teilnahme an der Studie eine win-win-Situation.“
„Ich freue mich immer sehr über den Austausch mit den diversen CARE-Mitarbeitern, ich bin dankbar, dass ich diesbezüglich einiges dazu lernen durfte und schätze die Unterstützung bezüglich dem Thema Allergien/Unverträglichkeiten bei Kindern.“

Was wird untersucht und was bedeutet das für Sie
Im ersten Lebensjahr:
Kurze wöchentliche Fragebogen zu Ernährung und Gesundheit (online oder auf Papier, in verschlüsselter Form),
Einsenden von 5 Stuhlproben und 4 Visiten mit Hautuntersuchung:
- Bei Geburt Visite im Spital
- Im Alter von 3 Wochen Visite zuhause (durch Pflegefachfrau)
- Im Alter von 4 Monaten Visite am Kinderspital
- Im Alter von 12 Monaten Visite am Kinderspital mit Allergietestung
Ab dem zweiten Lebensjahr:
Fragebogen zur Ernährung und Gesundheit (online oder auf Papier, in verschlüsselter Form), Einsenden von
Stuhlproben:
- Im Alter von 18 Monaten
- Im Alter von 2 Jahren und 3 Jahren inkl. Visite am Kinderspital mit Hautuntersuchung und Allergietestung
„Es sind zwar viele Fragen und Probenpäckli, die wir beantwortet resp. zurückgesendet haben, sowie einige Untersuchungen am Kispi, wo wir profitiert haben von sehr wertvollen Tipps, die nicht nur der Studie helfen. Ich selbst habe viel über mein drittes Kind erfahren, was ich über die ersten beiden nicht gewusst habe.“


Unser Team freut sich auf Sie und Ihre Teilnahme.

Caroline Roduit

Kristina Heye

Neeta Bühler
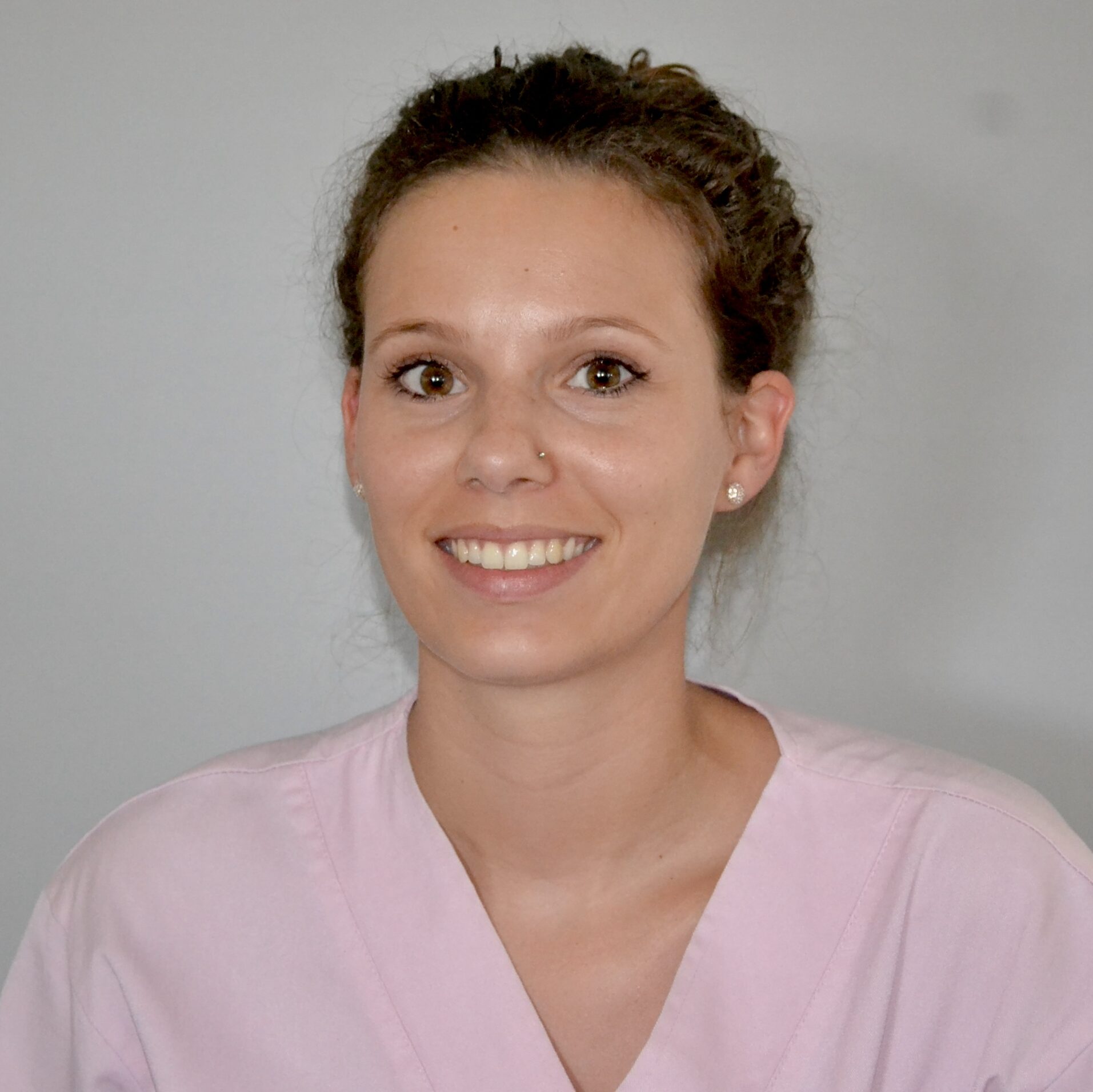
Carina Bischof