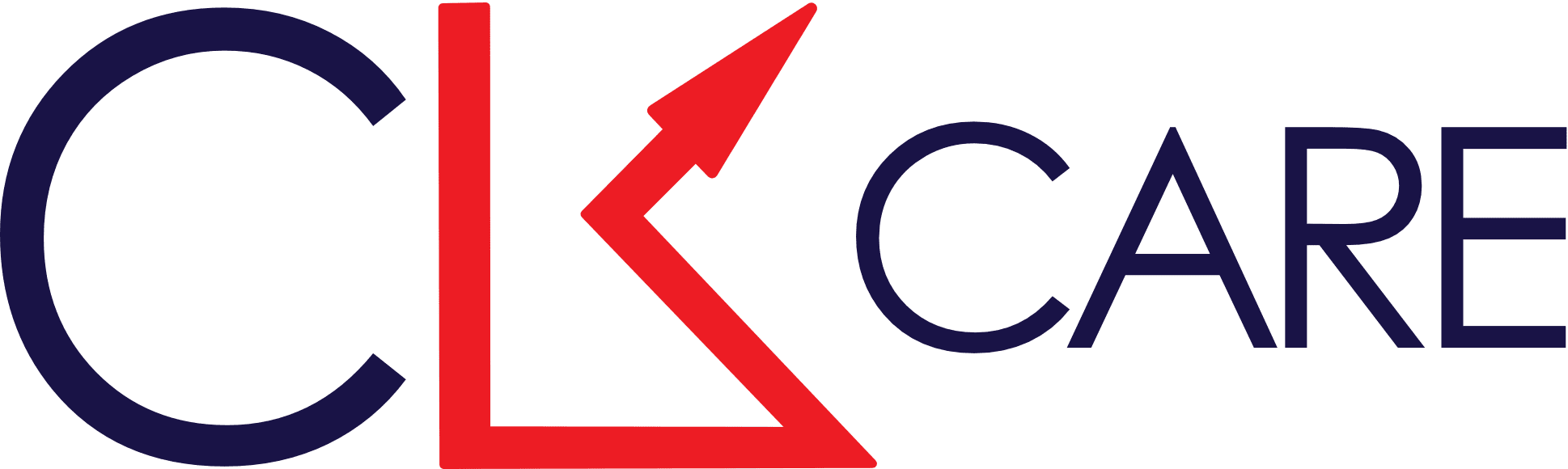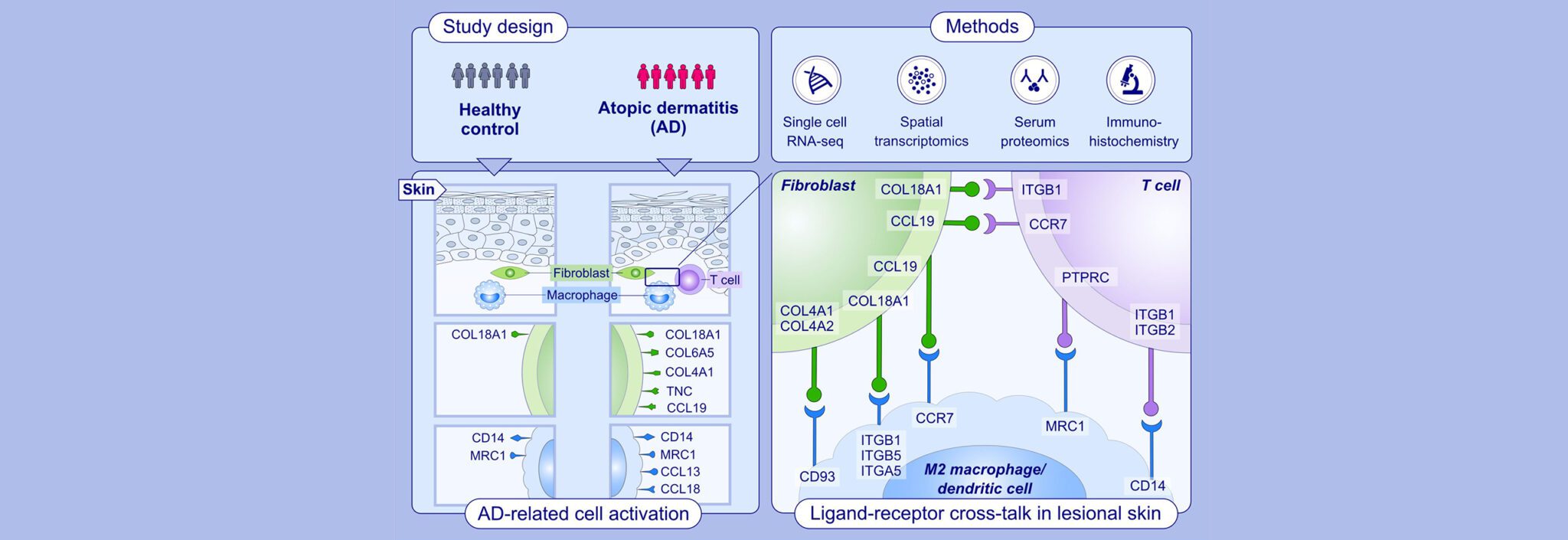Es gibt immer noch keine Therapie, die Kinder mit Asthma und allergischen Erkrankungen vollständig kurieren kann. Behandlungen konzentrieren sich auf die Symptombekämpfung. Die Beschwerden können so gelindert werden, sind aber vom Patienten üblicherweise über sehr lange Zeiträume oder gar lebenslang anzuwenden. Die beste Langzeittherapie ist immer noch die Vermeidung des auslösenden Allergens, z.B. bestimmter Nahrungsmittel.
Bisher wurden von der Forschung keine wirkungsvollen Strategien zur Prävention von Allergien gefunden. Deshalb ist die Entwicklung neuer Konzepte eine Notwendigkeit.
Die Prävention von Allergien durch die Ernährung im frühen Kindesalter ist ein solches Konzept, das Beachtung verdient. Bis vor Kurzem bestand Prävention einzig darin, dass man dazu riet, bestimmte Nahrungsmittel zu meiden, ganz besonders im Säuglings- und Kleinkindalter. Die neuesten Empfehlungen zielen aber nicht mehr in diese Richtung. Denn es konnte nicht bewiesen werden, dass das Weglassen bestimmter Nahrungsmittel oder deren späte Einführung Allergien verhindern kann. Ganz im Gegenteil konzentrieren sich neue Vorschläge darauf, dass der frühe Kontakt zu Allergenen eine Immuntoleranz induzieren kann. So öffnet sich möglicherweise ein Zeitfenster im frühen Kindesalter zur Verhinderung einer Entwicklung von Allergien.
In unserer Bauernkindstudie (PASTURE/EFRAIM) haben wir bereits zeigen können, dass vielseitige Beikost im ersten Lebensjahr das Risiko einer atopischen Dermatitis reduziert. Denselben Effekt konnten wir auch für Asthma, Nahrungsmittelallergie und allergische Sensibilisierung nachweisen. Unabhängig davon konnten wir auch den schützenden Effekt von Beikost, vor allem Milchprodukten (z.B. Joghurt), die im ersten Lebensjahr eingeführt wurden, zeigen (wie im Newsletter vom Oktober 2012 beschrieben).
Unsere Erkenntnisse aus der Bauernkindstudie unterstützen die Hypothese, dass im kindlichen Darmtrakt ein früher Kontakt zu verschiedenen Allergenen für die Entwicklung einer Immuntoleranz notwendig ist. Die Art der Ernährung, die Darmflora und die Immunantwort hängen eng zusammen. Eine mögliche Erklärung für den schützenden Effekt könnte die frühe Besiedelung des Darmes mit Keimen und deren Stoffwechselprodukte sein. Es wurde bereits gezeigt, dass die sogenannten kurzkettigen Fettsäuren, Stoffwechselprodukte von gewissen Darmbakterien, eine antientzündliche Wirkung besitzen. Diese kurzkettigen Fettsäuren werden durch die Fermentation von Kohlenhydraten im Darmtrakt generiert, sind aber auch in der Nahrung enthalten. Eine dieser Fettsäuren, Butyrat, ist in den Triglyceriden der Kuhmilch enthalten, deshalb ist der natürliche Butyrat-Gehalt in Milchprodukten hoch.
Im Mausmodell der allergischen Atemwegentzündung (ähnlich wie Asthma) konnten wir erstmals den präventiven Effekt von kurzkettigen Fettsäuren beobachten. Wir haben den Mäusen über die gesamte Dauer des Experiments die kurzkettigen Fettsäuren oral verabreicht. Normalerweise befinden sich in einer gesunden Lunge nur einige Makrophagen, die die Lunge durchwandern. Sobald eine Allergie ausgelöst wird, steigt die Zellzahl in der Lunge stark an, was vor allem auf dem Einwandern von eosinophilen Zellen beruht. Wir haben die Lungen von Mäusen in unserem Allergie-Modell ausgewaschen und die darin enthaltenen Zellen gezählt. Dabei konnten wir zeigen, dass die Gabe von kurzkettigen Fettsäuren die Anzahl der in der bronchoalveolären Lavage (BAL, Auswaschung der Lunge) enthaltenen Zellen deutlich reduzieren kann.
Auch für eine Allergie typische Botenstoffe gehen durch die Gabe von kurzkettigen Fettsäuren deutlich zurück, was den schützenden Effekt dieser kurzkettigen Fettsäuren in einer Allergie weiter bestätigt.
Diese vielversprechenden Resultate im Mausmodell lassen uns weitere Projekte dieser Richtung in Angriff nehmen. Geplant sind Gaben von kurzkettigen Fettsäuren kombiniert mit einem Butyrat verstärkenden Substrat und ebenso von Butyrat produzierenden Probiotika.
In der Bauernkindstudie planen wir, den Gehalt an kurzkettigen Fettsäuren in Stuhlproben aus dem ersten Lebensjahr zu untersuchen. Der Zusammenhang zwischen Fettsäuregehalt und Ernährung soll untersucht werden.
Die oben beschriebenen Resultate weisen in eine Richtung, die die Entwicklung von wirkungsvollen Ernährungsstrategien zur Prävention allergischer Erkrankungen möglich macht.